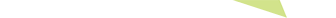Vielfalt des Schweizer Systems: Romandie im Fokus

Im Bild: Vincent Michellod, Generaldirektor, Clinique Générale-Beaulieu (Swiss Medical Network Gruppe) in Genf
Die Reaktionen der Politik und der Tarifpartner auf die bekannte Problematik wachsender Gesundheitskosten beeinträchtigen zunehmend die Tragfähigkeit der Gesundheitseinrichtungen. Die Herausforderungen, die es zu bewältigen gilt, sind beträchtlich und die Massnahmen, die dazu ergriffen werden, können in der Schweiz je nach Region variieren. Vincent Michellod erläutert die Situation in der Romandie und insbesondere in Genf, wo er als Generaldirektor der Clinique Générale-Beaulieu (Swiss Medical Network Group) tätig ist.
Wenn wir die Schweizer Tariflandschaft und deren Tarifmodelle betrachten, welche Herausforderungen sehen Sie im Schweizer Gesundheitswesen für die Spitäler in den kommenden Jahren, insbesondere in der Westschweiz? Wo besteht Ihrer Meinung nach der grösste Reformbedarf? Welche innovativen Tarifprojekte | Pilotversuche kommen Ihnen in den Sinn?
Das Spitalwesen durchlebt eine beispiellose Krise. Die Spitäler haben mit teilweise massiv steigenden Kosten für Produktionsfaktoren zu kämpfen, können diese aber nicht auf die Preise umwälzen. Der anhaltende Preisdruck ist eine politische Massnahme, um den Kostenanstieg auf ein sozialverträgliches Mass zu begrenzen, verstösst jedoch gegen alle geltenden betriebswirtschaftlichen Grundsätze.
In der Romandie schlägt sich dieser Druck stärker als andernorts in einem wachsenden Defizit der öffentlichen Einrichtungen nieder. Er gefährdet auch das nicht subventionierte private Angebot, das effizienter und für die Deckung des Bedarfs notwendig ist. Meiner Ansicht nach müssen wir dringend einen Paradigmenwechsel vollziehen, wenn wir nicht wollen, dass unser System in eine Systemkrise abrutscht, die sich zwangsläufig auf die Qualität der medizinischen Versorgung auswirken würde.
Dieser Wandel wurde innerhalb der Swiss Medical Network Gruppe durch das Pilotprojekt im Jurabogen eingeleitet, bei dem es sich um die erste vollintegrierte Gesundheitsorganisation der Schweiz (Réseau de l'Arc) handelt. Inzwischen hat unsere Initiative Nachahmer gefunden und wir freuen uns darüber.
In Kürze wird eine neue ambulante Tarifstruktur entstehen (TARDOC und ambulante Pauschalen). Was steht für die Spitäler auf dem Spiel, insbesondere im Kanton Genf, der zurzeit mit allen Krankenversicherern ein Tariffestsetzungsverfahren beim BVGer durchführt?
Die Einführung der beiden neuen ambulanten Strukturen erfüllt gegensätzliche Erwartungen: Die Leistungserbringer erhoffen sich eine Aufwertung der ambulanten Medizin, während die Politik eine bessere Kontrolle der Kostenentwicklung erwartet. Bereits jetzt lässt sich sagen, dass diese beiden Ziele nicht zeitgleich erreicht werden können.
Das TARMED-System wurde aufgrund seiner Komplexität und Intransparenz kritisiert. Der Ersatz durch zwei unterschiedliche Strukturen wird sicherlich nicht dazu beitragen, dass es einfacher und übersichtlicher wird. In Genf trägt das hängige Verfahren noch zur Komplexität des Vorhabens bei. Der Kanton geht den Wechsel mit drei verschiedenen Taxpunktwerten an, die alle provisorisch sind. Das erschwert die Berechnung der Kostenneutralität erheblich.
Welche Herausforderungen werden die Spitäler – insbesondere in der Romandie – in den nächsten Jahren in Bezug auf die einheitliche Finanzierung von ambulanten und stationären Gesundheitsleistungen (EFAS) zu bewältigen haben? Welche Rahmenbedingungen werden sie im Rahmen der EFAS-Reform benötigen?
Bei EFAS handelt es sich um eine Finanzierungsreform und nicht um eine Tarifreform. Sie wird keinerlei Auswirkung auf die Spitäler haben. Tatsächlich ist die Reform für das Spitalwesen nur dann von Interesse, wenn sie den Weg für eine einheitliche Preisgestaltung der Leistungen ebnet, sprich für eine Vereinheitlichung der ambulanten und stationären Tarife.
Dabei handelt es sich vermutlich um den mit Abstand wirksamsten Hebel, der uns zur Neugestaltung der Spitalwesens und zur Eindämmung der steigenden Gesundheitskosten in der Schweiz zur Verfügung steht. Das ist zumindest die Erkenntnis, die alle Länder, welche die ambulante Wende erfolgreich umgesetzt haben, vermitteln, und das ist die Vision, welche die Swiss Medical Network Gruppe mit dem Konzept «Zero-night DRG» verfolgt.
Bei gesundheitspolitischen Abstimmungen sind die Ergebnisse in den verschiedenen Sprachregionen manchmal unterschiedlich. Was sind Ihrer Meinung nach die Gründe dafür? Kann man hier von einem «Röstigraben» sprechen?
Zweifellos gibt es regionale Besonderheiten, die über die sprachlichen Unterschiede hinausgehen. Die Kantone der Romandie vertreten im Allgemeinen eine eher staatsorientierte Sicht auf die Medizin: Sie verfolgen eine staatlich reglementierte Politik in Bezug auf die Planung und zögern nicht, tief in die Tasche zu greifen, um die Defizite ihrer Spitäler auszugleichen. Die deutschsprachigen Kantone zeichnen sich durch einen generell liberaleren Ansatz aus und zögern nicht, den Wettbewerb und die Marktmechanismen spielen zu lassen. Das Verhältnis kehrt sich auf individueller Ebene paradoxerweise um: Der Patient in der Westschweiz scheint mehr Wert auf seine Wahlfreiheit zu legen und Einschränkungen schwerer zu akzeptieren.
Was zeichnet Tarifverhandlungen aus und wie kommt man am Verhandlungstisch erfolgreich zu einer Tarifeinigung? Verstehen die Tarifpartner in der Westschweiz die Verhandlungen anders?
Das KVG-System untersteht dem Kontrahierungszwang. Die Tarifpartner sind daher gezwungen, sich zu einigen, und zwar auch langfristig. Deshalb entsprechen die Konditionen nicht denen einer klassischen Geschäftsverhandlung. Dank der schweizerischen Kompromisskultur hat dieses System bisher funktioniert, doch in den letzten 15 Jahren hat sich das Klima stark verschlechtert. Aufgrund der angespannten Lage in Bezug auf die Gesundheitskosten ist der Handlungsspielraum der Akteure erheblich eingeschränkt worden, sodass es manchmal gar keine gemeinsame Basis mehr gibt. In diesem Kontext ist es wichtiger denn je, dass die Tarifpartner den Dialog fortsetzen und zu einem gemeinsamen Verständnis für die Herausforderungen, mit denen die Branche konfrontiert ist, gelangen, zumal eine Verhandlungslösung immer besser ist als eine aufgezwungene Lösung.
Kulturelle Unterschiede bestehen und sind in der Literatur belegt, jedoch haben sie nie ein unüberwindbares Hindernis dargestellt. In der Romandie tendiert man dazu, sich in erster Linie auf die grundlegenden Prinzipien zu einigen und die Details auf die nachfolgenden Sitzungen zu verschieben. In der Deutschschweiz wird dagegen ein methodischeres und detaillierteres Vorgehen bevorzugt. Beide Herangehensweisen haben ihre Vor- und Nachteile: Im ersten Fall erreicht man schnell eine Einigung, wobei jedoch das Risiko besteht, bestimmte Anwendungsmodalitäten zu vernachlässigen. Im zweiten Fall überlässt man nichts dem Zufall, verliert aber mitunter Zeit, bevor man eine grundlegende Meinungsverschiedenheit erkennt.
Die Kosten für medizinisch erbrachte und weiterverrechnete medizinische Leistungen ergeben sich aus Menge x Preis (Tarif). Welche Lösungsansätze sehen Sie, das Kostenwachstum zu kontrollieren und einzudämmen?
Wie bei jeder Dienstleistung sind auch für medizinische Leistungen primär menschliche Ressourcen erforderlich. Genau gesagt sind es 80 Prozent. Ein Ansatz, der auf einem Einheitspreis der Leistung basiert, stösst daher schnell an seine Grenzen, zumal qualifizierte Fachkräfte zunehmend rar werden. In dieser Hinsicht ist es paradox, dass sich der Grossteil der politischen Massnahmen zur Reduzierung der Gesundheitskosten bisher auf diesen Parameter konzentriert haben.
Um die Gesundheitskosten nachhaltig zu senken, müssen wir also die Menge der in Anspruch genommenen Leistungen in den Griff bekommen. Dies ist der Grund, warum die Swiss Medical Network Gruppe ihre Strategie fortan auf die schnelle Entwicklung integrierter Versorgungsorganisationen in der gesamten Schweiz ausrichtet. Nach der ersten gelungenen Erfahrung im Berner Jura (Réseau de l'Arc) wurde 2025 die zweite Organisation im Tessin ins Leben gerufen. Diese vertikale Integration der Versorgungskette stellt den innovativsten Schritt der letzten 20 Jahre dar und hat eine bessere Verwaltung des Gesundheitskapitals der Bevölkerung zum Ziel. Dies ist der Preis, den wir zahlen müssen, um die Menge der in Anspruch genommenen Gesundheitsleistungen zu beeinflussen und die Kosten, die unser Gesundheitssystems generiert, zu bewältigen.
Herzlichen Dank für das Interview, Herr Michellod!
Das Interview führte Nathalie Ducret, Verhandlungsleiterin und Stv. Tarifmanagerin, Einkaufsgemeinschaft HSK AG.
Wie interessant ist der Artikel für Sie?
Publikationsdatum
16. April 2025
Ihr direkter Kontakt

Nathalie Ducret