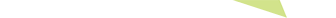Spitalfinanzierung – 5 Jahre nach Einführung des neuen Tarifsystems
Im Interview spricht Wolfram Strüwe, Leiter der Abteilung Gesundheitspolitik bei Helsana und neues Verwaltungsratsmitglied der Einkaufsgemeinschaft HSK, unter anderem über Veränderungen in der Spitallandschaft, die Rolle der Kantone und welche Vorteile das neue System den Patienten bringt.
Herr Strüwe, sehen Sie die Einführungsphase von SwissDRG als abgeschlossen?
Ja, in der Tat, die Einführung ist abgeschlossen. Sie bezog sich im Wesentlichen auf zwei Aspekte: es gab neue gesetzliche Bestimmungen zur Spitalfinanzierung. Hier hat das Bundesverwaltungsgericht mit so manch überraschendem Urteil weitestgehend für Klarheit gesorgt. Ein Beispiel ist die Zulässigkeit von Gewinnen in der Grundversicherung. Zum anderen bestand Unsicherheit darüber, ob das System auch wirklich funktioniert, die Leistungsbereiche adäquat abgebildet sind. Dieser Angst wurde mit spital-individuellen Baserates erfolgreich begegnet.
Wir befinden uns mittlerweile im sechsten Jahr der Anwendung und sehen, es funktioniert. Dank der SwissDRG AG gab es jedes Jahr eine neue Tarifversion, die Verbesserungen brachte. Genau dies meint man, wenn man von einem «lernenden System» spricht. Vielleicht sollte man aber besser von System im «Work-in-progress-Modus» reden, denn ein solches System ist nie wirklich fertig. Zum einen ist die Systemlogik immer wieder zu justieren; zum anderen schreitet die medizinische Entwicklung voran, so dass immer möglichst zeitnahe neue Entwicklungen einzubauen sind. Hier kommt dem Antragsverfahren beim Bundesamt für Statistik besondere Bedeutung zu, denn die Abbildung des Neuen in die Klassifikationen ist zentral.
Was hat sich in den 5 Jahren nach der Einführung von SwissDRG in der Spitallandschaft verändert?
Der Gesetzgeber wollte mit der neuen Spitalfinanzierung den Wettbewerb unter den Spitälern intensivieren, um so die Kostenentwicklung zu dämpfen. Grundlegend war dabei die Abkehr vom sogenannten Kostenerstattungsprinzip, die Einführung der Leistungsfinanzierung sowie der neue Preisbildungsmechanismus, also das Benchmarking bei den Baserates.
Momentan lassen sich zwei Tendenzen identifizieren: zum einen geraten einige Spitäler unter massiven Finanzierungsdruck. Beispiele lassen sich von Appenzell über Basel-Land bis nach Neuenburg finden. Zum anderen zeigt der neue Ausgabenreport von Helsana, dass es mit der beabsichtigten Spezialisierung bei den Spitälern noch nicht weit her ist. Kleine Spitäler konnten sogar Marktanteile zu Lasten der Grossen gewinnen. Da darf man gespannt sein, wie das weitergeht.

Wolfram Strüwe im Interview mit Isabel Riedel-Schulz.
Ziel dieses Systemwechsels war es unter anderen durch mehr Transparenz und Kostenwahrheit den Wettbewerb zwischen den Spitälern zu fördern. Wurde dieses Ziel erreicht und inwieweit profitieren die Patienten davon?
Die Transparenz ist gekommen, keine Frage. Hatte man früher Tages- oder Abteilungspauschalen und wusste eigentlich gar nicht so recht, was genau gemacht wurde, so liegen heute sämtliche Diagnosen und Behandlungen vor. Diese Transparenz führt nicht nur zu viel sinnvolleren Kostenvergleichen als früher, nein, nun werden auch die Leistungen selber, die am Patienten erbracht werden, Gegenstand der Diskussion. Wir haben ja deshalb die neue Leistungsfinanzierung bewusst mit einer systematischen Qualitätsmessung in den Spitälern verknüpft. Stichwort ist hier der Nationale Verein für Qualitätsentwicklung in Spitälern und Kliniken (ANQ). Man könnte zwar noch mehr Indikatoren erheben, aber ein Anfang ist gemacht. Von der Verknüpfung dieser beiden Aspekte profitieren die Patienten ganz unmittelbar.
Mit der Kostenwahrheit ist das so eine Sache; das Zauberwort ist da die «gemeinwirtschaftliche Leistung». Unter diesem Titel haben die Kantone auch heute noch die Möglichkeit, ihre Spitäler zu subventionieren, obwohl 2012 die Objektfinanzierung zu Gunsten der Subjektfinanzierung, also der Finanzierung des Patienten, abgeschafft wurde. Unrühmliches Beispiel ist hier Genf. Nicht nur, dass über kontingentierte Leistungsaufträge versucht wird, Zusatzversicherten den kantonalen Beitrag zu verweigern, nein: laut einer Studie der Universität Basel wird jeder stationäre Fall am Uni-Spital noch mit 15'000 Franken zusätzlich subventioniert. Kein Wunder, dass das Parlament nun den Bundesrat beauftragt hat, die kantonalen Zuschüsse zu untersuchen.
Sieht man das mit der Kostenwahrheit etwas dynamischer, wird es mit der momentanen Investitionswelle im Spitalsektor noch dramatisch, denn eins ist sicher: diese zweistelligen Milliardenbeträge werden nicht vollständig von der Grundversicherung finanziert werden können.
Welche Rolle spielen die Kantone bei der neuen Spitalfinanzierung?
Seit Bestehen der Eidgenossenschaft ist bekannt, dass jeder Kanton erstmal für sich selber schaut. Dieses Denken ist gerade im Gesundheitswesen besonders ausgeprägt. Wir haben eine duale Spitalfinanzierung, bei der die Kantone mindestens 55% der Fallpauschale aus Steuermitteln finanzieren. Es gelten dabei offensichtlich zwei Grundprinzipien: auf der einen Seite dürfen kantonale Mittel keinesfalls in andere Kantone abfliessen, denn das ist Sünde. Obwohl der Gesetzgeber vorsah, dass die Patienten bei Listenspitälern die freie Wahl haben, sind der kantonalen Kreativität, dies zu verhindern, kaum Grenzen gesetzt. Auf der anderen Seite haben wir das gerade angesprochene Instrument der «gemeinwirtschaftlichen Leistung», das für die Strukturerhaltung eingesetzt wird.
Aber, was für die Kantone seit 2012 neu ist und zunehmend zum Problem wird: sie können nicht mehr eine explizite Defizitdeckung bei ihren Spitälern betreiben, sondern sind über die Fallpauschale direkt in die Finanzierung eingebunden. Über die Anzahl Fälle haben sie aber keine Kontrolle und mehr Fälle bedeutet unmittelbar mehr Steuermittel. Da kann ein Kantonsparlament wie in Luzern schon mal laut werden, wenn immer mehr Mittel über Nachtragshaushalte eingefordert werden. Es verwundert also nicht, dass gerade jetzt die Diskussion um ambulante Listen aufkommt. Man versucht einfach den eigenen Finanzierungsanteil auf den Prämienzahler abzuwälzen. Dabei wär eine einheitliche Finanzierung von ambulanten und stationären Leistung, die wir momentan politisch forcieren, die richtige Therapie.
In Deutschland gibt es das DRG-System bereits seit dem Jahr 2003. Lassen sich die Entwicklungen seit Einführung der Systeme in beiden Ländern miteinander vergleichen?
Gesundheitssysteme lassen sich nur schwer miteinander vergleichen, da es immer nationale Settings sind. Eines fällt aber auf: in Deutschland will man die Baserates vereinheitlichen. Auf Länderebene ist dies ja schon seit längerem Realität. In der Schweiz mit dem KVG findet sich dazu keine Vorgabe. Die Tarifpartner sehen in einem wettbewerblichen System auch gar keinen Bedarf. Allein der Bundesrat spricht jedes Jahr bei der Genehmigung der Tarifstruktur SwissDRG davon. Das erstaunt und bleibt wohl auch weiterhin sein Geheimnis. (W. Strüwe lacht)
Interview: Isabel Riedel-SchulzWie interessant ist der Artikel für Sie?
Publikationsdatum
23. Mai 2017
Ihr direkter Kontakt

Riadh Zeramdini